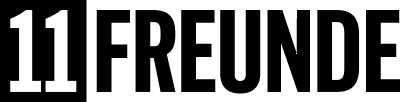M an merkt es Hans-Werner Schramm nicht direkt an, aber Hans-Werner Schramm hat mehr als zwei Augen. Sie sehen so scharf, dass er jeden einzelnen der 33.981 Zuschauer, die sich heute ins Berliner Olympiastadion verirrt haben, ganz genau erkennen kann. Lässt jemand ein Bier fallen, etwa im Rundgang um den Oberring, bekommt Hans-Werner Schramm das mit. Zündeln Ultras in der Ostkurve, weiß Schramm wenig später Bescheid. Kloppen sich zwei Besucher im Gästeblock, könnte Schramm danach beschreiben, welcher der beiden länger nicht beim Friseur gewesen ist. Nun ist Schramm natürlich kein Mutant, sondern ein physiognomisch nicht ungewöhnlicher Polizist. Und die dutzenden Augen sind in Wirklichkeit nicht seine, sondern Kameras. Aber, und das ist wichtig: Mit ihnen sieht Schramm alles. Schließlich soll er, Polizeioberrat der Berliner Polizei und heute Einsatzleiter, aufpassen, dass nichts passiert. Und falls doch etwas passiert, soll er zumindest wissen, wer es war.
Heute – ein Samstag Anfang März, Hertha trifft zu Hause auf Mainz 05 – steht Hans-Werner Schramm in seiner Einsatzzentrale, der »Skybox«. Die liegt zwar nicht direkt im Himmel, aber fast. Denn wenn Schramm da so steht, in dem schmalen und schlauchförmigen Raum, eingeklemmt zwischen Dach und Haupttribüne des Olympiastadions, wenn er durch die großen Glasscheiben schaut, mal nach rechts unten, mal nach links unten, dann wirkt es, als befände er sich in einer anderen Sphäre. Und nicht in einem Fußballstadion. Vom Lärm da draußen hört er nichts, hier drinnen ist es still. Die kleine Tür dämpft das Getrommel und Getöse ab, den Rest verschluckt der dunkle Filzteppich. Der Blick ist fantastisch. Als würde Schramm von einer Wolke aus über sein Stadion wachen. Nur dass es nicht nach Himmel riecht, sondern nach Hackbraten. Den haben die Kollegen mitgebracht. Genau wie den Kartoffelsalat. So machen sie es bei jedem Heimspiel.
»Bei uns ist doch eh nüscht los«
Es läuft die sechste Spielminute und auf dem Platz passiert so wenig wie auf den Kamerabildern, die über die nebeneinander aufgereihten oder teilweise übereinander gestapelten Flachbildschirme laufen. Schramms Kollegen sitzen vor dem knappen Dutzend Computern – gefühlt eher Windows 95 als etwas aus diesem Jahrtausend – trinken Kaffee, verputzen Hackbraten und passen auf. Am Eingang vom Olympiator? Alles ruhig. Das kleine Waldstück zwischen S-Bahnhof und Stadion? Nichts Verdächtiges zu sehen. Die VIP-Parkplatz-Einfahrt? Nur zwei Ordner, die gelangweilt herumstehen. Und weil auch weder die verkleideten Mainzer im Gästeblock noch die singenden Berliner Fans in der Ostkurve Anlass zur Sorge bieten, hat Schramm – graue Haare, auf dem blauen Uniform-Hemd zwei goldene Oberrat-Sterne aufgenäht, Dienstwaffe am Gürtel – Zeit zum Plaudern. »Früher stand ick selber im Block, als Fan, damals spielte hier noch Erich Beer«, sagt er freundlich und nickt dabei in Richtung Ostkurve. Doch mittlerweile ist das nichts mehr für ihn. Er wisse zwar genau Bescheid über das, was im Block so abgeht, welche Utensilien den Ultras heilig sind, wie sensibel das Thema Pyro für die Szene ist, aber: »Ick will, dass sich sich die normalen Fans deutlicher von den Straftätern distanzieren.« Das Telefon klingelt. Also eines der sechs Telefone, die zusammen mit den Monitor- und Laptop-Anschlüssen für ordentlich Kabelgewurschtel auf den Tischen sorgen. Eine Kollegin nimmt ab. »Anruf aus dem Mommsenstadion«, ruft sie durchs Schlauchbüro. »30 alkoholisierte Stendal-Fans beim Spiel von TeBe.« Das Mommsenstadion liegt genau wie das Olympiastadion in Schramms Zuständigkeitsbereich. Zeitgleich mit Hertha trifft Tennis Borussia Berlin dort auf Blau-Weiß Stendal. »Na dann schick doch einfach die LER rüber«, sagt Schramm, gemütlich, ohne Hast. Die LER ist die Landeseinsatzreserve, eine Hundertschaft. »Bei uns hier ist doch eh nüscht los.«
Polizeioberrat Hans-Werner Schramm stand früher selber in der Kurve.
425.781,11 Euro Mehrkosten – für ein Fußballspiel
Da in und um Stadien herum nicht immer alles so friedlich abläuft wie in der sechsten Minute beim Spiel zwischen Hertha und Mainz, ist die Polizei trotzdem stets im Großeinsatz. Und diese Einsätze sorgen auf mehreren Ebenen und zwischen verschiedenen Parteien immer wieder für Konflikte. Da wäre zum Einen die Frage nach der Finanzierung. Wer soll das alles eigentlich bezahlen? Normalerweise ist der Staat für die Sicherheit im öffentlichen Raum zuständig, also auch für das, was rund um ein Bundesligaspiel passiert. Doch 2016 kam es zwischen dem Stadtstaat Bremen und der DFL, der Vereinigung der Profiklubs der beiden Bundesligen, zu einem bis heute andauernden Rechtsstreit.
Im Kern geht es dabei um die Finanzierung von Hochrisikospielen, die den Staat (und somit den Steuerzahler) wesentlich teurer zu stehen kommen als herkömmliche Partien. 2016 schickte das Land Bremen nach dem als Hochrisikospiel eingestuften Nord-Derby zwischen dem Hamburger SV und Werder Bremen einen Gebührenbescheid an die DFL. 425.781,11 Euro Mehrkosten seien durch den Einsatz entstanden. Doch die DFL wollte und will noch heute nicht zahlen, sie verweist auf die Summe von 1,2 Milliarden Euro, die die Klubs in Form von Steuern ohnehin schon jährlich an den Staat abdrücken. Der Fall ging vom Verwaltungsgericht, das der DFL Recht gab, zum Oberverwaltungsgericht, das wiederum dem Land Bremen Recht gab. Dann wurde eine Ebene höher gestritten, vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. Ende März verkündete das Leipziger Gericht dann: nichts. Statt ein Urteil zu sprechen, verwies das Bundesverwaltungsgericht den Fall zurück an die Vorinstanz. Wo der Streit nun in die nächste Runde geht, in eine womöglich entscheidende Runde, die mit Spannung erwartet wird. Schließlich befürwortet die überwältigende Mehrheit der Deutschen, laut WDR sogar 90 Prozent von 1000 Befragten, eine direkte Beteiligung der Vereine an den Mehrkosten. Nach dem Motto: Eure Rowdys, euer Problem. Bloß: Warum sind die Einsätze überhaupt so teuer? Warum kommt die Polizei allein in den beiden Bundesligen auf 1,62 Millionen Arbeitsstunden in der Saison 2017/2018? Warum sind umgerechnet 1250 Beamte hauptamtlich mit der ersten und zweiten Liga beschäftigt?
Von der »Skybox« aus wachen Schramm und seine Kollegen über das Olympiastadion.
Sucht man nach Antworten, landet man schnell bei einem anderen, wahnsinnig verkrusteten Konflikt: dem zwischen der deutschen Polizei und den deutschen Ultras. Dabei geht es um essentielle, gesellschaftlichen Fragen. Wie viel Einmischung sollte dem Staat erlaubt sein? Wieviel Verständnis bringt die Mehrheit einer Subkultur wie der der Ultras entgegen? Und: Wem gehört der Fußball eigentlich? Von Seiten der Ultras ist dann oft die Rede von fehlendem Fingerspitzengefühl. Von Schikane. Von überzogenen Einsätzen, was Ausrüstung und Manpower der Polizei (und also auch die Kosten) angeht. Von der Kriminalisierung friedlicher Fans. Von Panikmache wie im Frankfurter Fall, als Hessens Innensenator Peter Beuth nach einem (tatsächlich vollkommen harmlosen) Interview von Eintracht-Präsident Peter Fischer Lagerräume der Ultras durchsuchen ließ. Von unlauter gesammelten Daten wie im Leipziger Fall, als 921 Telefonanschlüsse von Chemie-Fan angezapft wurden, denen der Staat die Gründung einer linksextremen Vereinigung nachweisen wollte. Und, im schlimmsten Fall, von Polizisten, die selber gewalttätig werden und jede Chance nutzen, um mal ordentlich draufzuhauen.
»Ganz Berlin hasst die Polizei«
Auf der anderen Seite die Polizei. Die laut Jahresbericht der Zentralen Informationsstelle Sporteinsätze (ZIS) von 13.625 »gewaltbereiten« und »gewaltsuchenden« Anhängern in den ersten drei Ligen ausgeht. Der Gesänge wie »Ganz Berlin hasst die Polizei« entgegen gegrölt oder A.C.A.B.-Plakate (»All Cops Are Bastards«) entgegen gestreckt werden. Deren Einsatzkräfte Wochenende für Wochenende Überstunden ansammeln und die, wenn es denn eskaliert, die eigene körperliche Unversehrtheit aufs Spiel setzen. Eskaliert war es mal wieder im Herbst 2018, als Hertha in Dortmund spielte. Noch heute ist die Frage, wer daran die Schuld trägt, umstritten. Fest steht nur: Hertha-Ultras zündeten im Gästeblock Pyro, die Nordrhein-Westfälische Polizei ging danach – sehr untypisch – direkt vor den Block und versuchte – noch sehr viel untypischer – das Banner einer Ultragruppe sicherzustellen. Danach kam es zu schweren Ausschreitungen. Auf Polizisten wurde mit Plastikstöcken eingeprügelt, die Beamten prügelten mit Schlagstöcken zurück. Nach Behördenangaben wurden sechs Beamte und 45 Stadionbesucher verletzt. Außerdem verwüsteten Gästefans zwei Sanitäranlagen im Gästebereich, rissen Pissoirs, Waschbecken und sogar ganze Kloschüsseln aus den Wänden.
D ass ein Fotograf und ein Journalist die »Skybox« im Berliner Olympiastadion überhaupt betreten dürfen, liegt an Polizeihauptkommissar Heiko Homolla. Seit 1980 arbeitet der für die Polizei, unter anderem war er 18 Jahre lang szenekundiger Beamter. Einer derjenigen Polizisten, die gezielt eingesetzt werden, um Informationen über »gewaltgeneigte« (Kategorie B) und »gewaltsuchende« (Kategorie C) Fans zu sammeln. Lange kümmerte sich Homolla um die schweren Jungs in Frankfurt, dann noch für vier Jahre als Teil der Ermittlungsgruppe Hooligans (EG Hooligans) des LKA um die in Berlin. Auch bei Länderspielen und Turnieren war er im Einsatz. 1998 hatte er Schicht in Lens, als der französische Polizist Daniel Nivel von deutschen Hooligans ins Koma getreten wurde. Schlimm sei auch ein Spiel in Berlin gewesen, Deutschland gegen England, britische und einheimische Hools außer Rand und Band. Bierbänke seien damals geflogen, auch Biertische, ach, eigentlich alles Mögliche. Seit 2009 ist Homolla »raus aus dem aktiven Fußballgeschäft«, mittlerweile arbeitet er als »Leiter Öffentlichkeitsarbeit und Prävention« der Direktion 2. Und ist damit der Ansprechpartner für das Anliegen von 11FREUNDE, die Berliner Polizei bei einem Bundesligaeinsatz zu begleiten.
Knapp dreieinhalb Stunden bevor in der »Skybox« das Telefon klingeln wird, steht Homolla auf dem Coubertin-Platz vor dem Olympiastadion, direkt da, wo englische und deutsche Hools gewütet hatten, und erklärt erstmal die Basics. Es gab zwar schon ein Vorgespräch, aber um die Abläufe und Zuständigkeiten und Begriffe wirklich zu kapieren, hört man sie besser zweimal. »Abschnitt 22 ist Teil der Direktion 2«, sagt Homolla, der auch Jahre nach der aktiven Fußballbeamten-Karriere noch breit und kräftig wirkt wie ein junger Polizist. »Die Direktion 2 kümmert sich um die Bezirke Charlottenburg-Wilmersdorf und Spandau. In diesem Zuständigkeitsbereich liegt das Olympiastadion. Findet dort ein Hochrisikospiel statt, zum Beispiel Hertha gegen Frankfurt, kümmert sich Direktionsleiter Stefan Weiß selber um den Einsatz. Die Klassifizierung eines Spiels wird bei der sogenannten Beurteilung der Lage in den Wochen vor dem Spiel vorgenommen. Für hochrangige Spiele wie das DFB-Pokalendspiel oder Partien der deutschen Nationalmannschaft gibt es eine übergeordnete Sondereinheit, die Direktion Einsatz. Für normale Bundesligaspiele sind die zu Direktion 2 gehörenden Abschnitte 21 bis 26 verantwortlich. Und heute ist das der Abschnitt 22 mit Polizeioberrat Hans-Wender Schramm.« Puh.
»Etwas wirklich Extremes habe ich beim Fußball nie erlebt«
Neben Homolla steht Daniela Peters. Hauptkommissarin, schmal und sportlich, die kurzen blonden Haare schräg über die Stirn gekämmt, seit 25 Jahren im Dienst. Früher in Hundertschaften und im »Funkwageneinsatzdienst«, also auf Streife, jetzt als Sachbereichsleiterin der Öffentlichkeits- und Pressearbeit der Direktion 2. Sie ist die Stellvertreterin von Heiko Homolla. Und: Sie friert nicht. Das ist deshalb wichtig, weil sie normalerweise frieren würde an einem kalt-grauen Tag wie heute. Dann, wenn sie in Uniform hier wäre und nicht in Zivil. »An der Uniform ist alles aus Plastik. Da muss man sich zehn Schichten übereinander ziehen. Und trotzdem ist es am Ende kalt.« Ob sie, abgesehen von der Kälte, negative Erfahrungen gemacht habe als Polizeibeamtin beim Fußball? Pöbeleien, Rangeleien, Schlägereien? Früher, sagt sie, sei sie als eine der wenigen Frauen oft angebaggert worden. Komische Typen, komische Sprüche. Aber das habe sich stark verbessert. »Etwas wirklich Extremes, also was Gewalt betrifft, habe ich beim Fußball nie erlebt.« Krasser sei es in Kreuzberg gewesen, am ersten Mai. Der schwarze Block, die Pflastersteine, die rohe Gewalt. Dagegen sei es rund ums Stadion total entspannt. »Ich habe die Einsätze bei Spielen eigentlich immer genossen. Man ist an der frischen Luft. Zusammen mit Kollegen, die man mag. Und ist gerade nichts zu tun, kann man auch mal eine Runde Schafkopf spielen.«
Ist man mit Heiko Homolla und Daniela Peters unterwegs, hat das den großen Vorteil, dass man überall schnell und unkompliziert reinkommt. Zunächst in den Stadionbereich selbst, dessen Tore sich eigentlich erst um 13:30 Uhr öffnen und an dessen Eingängen sich gerade erst die orangenen Ordnungskräfte der Firma B.E.S.T. auf ihren Einsatz vorbereiten. Dann auch in die Stadionwache. Die liegt außerhalb des eigentlichen Stadions, ganz nah bei der Olympischen Glocke, und ist von außen vor allem eines: nicht zu sehen. Sie liegt versteckt, knapp zehn Meter unter der Erde. Um sie zu betreten, geht man auf ein Loch im Boden zu und steigt dann Treppen hinab wie in einen U-Bahnhof. Doch statt eines U-Bahnhofs findet man, unten angekommen, eine schwere Glastür und erreicht durch diese eine Dienststelle der Polizei. Die sieht von innen zunächst aus wie alles im Olympiapark: schwere, graue Steine, etwas träge, etwas duster, etwas einschüchternd. Umso lebendiger ist die Stimmung, wenn man in den büroartigen Teil der Wache, also nach rechts, abbiegt.
W ahnsinnig viele Menschen, die meisten mit Uniform oder zumindest mit Knopf im Ohr, wuseln durch den hell beleuchteten Flur, an den weiß gestrichenen Wänden hängen große Poster, Mannschaftsbilder von Hertha, Konzertplakate von Guns N’ Roses. Es riecht nach Kaffee, auch hier haben die Kollegen Essen mitgebracht, Würstchen und Salate und Kuchen und Schokoküsse. Es wird geklönt, über den Sohn, der endlich eine eigene Bleibe gefunden hat, über Herthas Abwehrchef Karim Rekik, der dämlicherweise gesperrt fehlt. Kurz: die Stimmung ist gelöst. Jetzt, es ist kurz vor 13:00 Uhr, bündelt sich die gute Laune in einem kleinen, engen Büro. Vier bürgeramtgraue Bürotische längs aneinander, einer quer vor Kopf. Zentrale Einsatzbesprechung. Am Ende sitzen und stehen dicht gedrängt mehr als 20 Personen im Raum. Kräfte der Bundespolizei, szenekundige Beamte, Zugführer von Hundertschaften, Vertreter des Sicherheitsdienstes B.E.S.T., Hertha-Geschäftsführer Thomas Herrich. Polizeioberrat Schramm, der Einsatzleiter, der später in der »Skybox« über den Einsatz wachen wird, sitzt vor Kopf und eröffnet die Runde mit einem Gag: »Teile der Mainzer Fans werden anscheinend das janze Wochenende in Berlin bleiben. Aber das kann ick jut verstehen: An Fassnacht würd ick auch nicht in Mainz sein wollen.« Danach werden Informationen ausgetauscht.
»Friedrich, Trennung, Berta, Trennung, 916«
Zunächst geht es um die Ankündigung der Mainzer Ultras, die Auswärtsfahrt unter dem Motto »Hassnacht« laufen zu lassen. Die hatte unter der Woche für Aufregung gesorgt, aber Schramm gibt Entwarnung: »Unseren Informationen zu Folje jeht es dabei nur darum, dass sie sich als Clowns verkleiden werden.« Dann rattert Schramms Assistentin, Frau Fischer, ein paar Zahlen runter. »Wir erwarten 700 Gästefans, davon 80-90 der Kategorie B und 5-15 der Kategorie C. Bei Hertha sind es 30 der Kategorie C. Insgesamt gehen wir von 35.700 Zuschauern aus.« Dann ist der Bundespolizist an der Reihe. Er bestätigt die Zahlen von Frau Fischer, spricht von zu erwartender »schwacher Kostümierung« der Gästefans. Vier Reisebusse seien aus Mainz unterwegs und kämen gegen 14:00 Uhr am Olympiastadion an. Er gibt die Kennzeichen durch wie ein Funker: »Friedrich, Trennung, Berta, Trennung, 916.« Ansonsten: keine weiteren Erkenntnisse. »Wir gehen von einem ruhigen Verlauf aus.« Weshalb womöglich die Zeit bleibt, um den Einsatz für etwas anderes zu nutzen. »Wir wollen versuchen, Hertha-Fans ausfindig zu machen, die bei den Krawallen in Dortmund dabei waren.« Zum Schluss spricht Hertha-Mann Herrich, der als Geschäftsführer von Vereinsseite aus für die Organisation und den Spielbetrieb verantwortlich ist. Verkleidungen könnten, wenn nötig, von Ordnern nachkontrolliert werden. Vor allem, wenn die Gesichter vermummt seien. Dann ist die Einsatzbesprechung vorbei. Nach knapp fünf Minuten. Der Ärger, die verkantete Wut, die Gewalt und Zuspitzung, gerade ist all das sehr weit weg.
Wachleiter Döse beaufsichtigt eine der modernsten Stadionwachen in Deutschland.
Als die Beamten das Büro verlassen, rückt der Ärger zumindest etwas näher. Denn am Empfangsschalter der Wache steht der erste Störenfried, rangeschafft von Einsatzkräften. Es ist weder ein aggressiver Fan, noch ein besoffener. Es ist ein Ordner. Kurz nachdem er sich zum Dienst gemeldet hatte, behauptete er plötzlich, eine Bombe dabei zu haben. Aus Spaß. Doch in dieser Hinsicht versteht der Sicherheitsdienst keinen Spaß. Spätestens seit dem Terroranschlag am Breitscheidplatz. Die Ordner übergaben den Mann an die Polizei. Weswegen der Ordner, ein junger Kerl, vielleicht 20 Jahre alt, jetzt den Prozess über sich ergehen lassen muss, der alle hier erwartet, die nicht freiwillig kommen. Wachleiter Döse klärt auf.
Wie in einer mexikanischen Würfelbude
Döse ist etwas kleiner und etwas runder als die Kollegen, die ihm seine Kundschaft bringen. Außerdem: freundliches Gesicht, graue Haare, roter Kopf, akkurat gestutzter Bart, Brille, Berliner Schnauze. Wie fast alle hier. »Einmal«, sagt Döse, »hatten wa hier 70 Festnahmen. Rekord.« Bei einem Spiel zwischen Hertha und Frankfurt sei das gewesen, noch lange, bevor die beiden Fangruppen sich 2017 in der Berliner Innenstadt gegenseitig die Köpfe einschlugen. Manche der Festgenommenen habe man im Flurbereich unterbringen müssen. »Wäre sonst zu eng jeworden.« Danach, sagt Döse, als die 70 Kerle wieder raus waren, habe es in der Stadionwache ausgesehen »wie in `ner mexikanischen Würfelbude«. Homolla hat ähnliche Geschichten parat. Eine davon erlebte er in Bochum. Der VfL spielte gegen Ajax, die deutsche Hool-Szene wollte Stärke zeigen und pilgerte ins Ruhrgebiet. »Am Ende nahmen wir 300 Mann fest. Da es nirgendwo genug Platz gab, brachten wir sie in eine Turnhalle. Und um sie zu beschäftigen, warfen wir einfach einen Fußball in die Mitte. Danach gab es keine Probleme mehr.«
Früher, also wirklich früher, so um 1913 rum, war die Wache hier in Berlin keine Wache, sondern die Kaiserloge von Kaiser Wilhlem dem II. Früher stand hier das Deutsche Stadion, das Mauerwerk ist noch original. Im Zuge der WM 2006 wurde renoviert. »Jetzt«, sagt Döse, ein bisschen stolz, »haben wir hier mit die modernste Wache Deutschlands.« Bedeutet: fünf kleine Einzelzellen (blaue Kachelwände, engmaschiges Eisengitter, fest verschraubte Holzpritsche), zwei etwas größeren Sammelzellen (blaue Kachelwände, engmaschiges Eisengitter, fest verschraubte Holzbänke), dazu Räume zum Abfotografieren und für die Fingerabdrücke. Und ein Arztzimmer, in dem den Festgenommenen, sobald der diensthabende Richter es am Telefon abgenickt hat, Blut abgenommen wird. Manchmal wirkt sich der Promillewert strafmildernd aus. Was vielleicht sogar genau jetzt, um 13:28 Uhr, der Fall sein könnte. Denn es gibt eine zweite Verhaftung. Am Empfangsschalter steht ein offensichtlich alkoholisierter Mann, um ihn herum zig Polizisten. Einem davon hatte er, noch außerhalb des Stadions, den Stinkefinger gezeigt. Jetzt grummelt er unverständliches Zeug vor sich hin. Um ihn ruhig zu stellen, setzen sie den Mann erstmal vor einen Fernseher. Sky, Vorberichte. »Das hilft meistens«, sagt Peters, die Hauptkommissarin.
Verstehen die Spaß? Als Clowns verkleidete Gästefans werden von der Polizei ins Stadion geleitet.
E ine knappe Stunde später, das Stadion füllt sich nur äußerst schleppend, biegen vier Reisebusse in den Scottweg am Olympiastadion ein. Die Mainzer Fans werden schon von einer Hundertschaft erwartet. Die Polizisten stehen mitten auf der Straße, in acht oder neun Zweierreihen hintereinander, breite Typen, ausrasierte Nacken. Sie tragen schwere Stiefel und dicke, dunkle Polizeiuniformen, die Dienstwaffen im Halfter, das Pfefferspray in einer extra Tasche. Dafür, dass sie gerade auf einen Haufen Mainzer Clowns warten und die Einsatzleitung von einem ruhigen Verlauf ausgeht, sehen sie einigermaßen furchteinflößend aus. Immerhin: Ihre Kampfhelme tragen sie in der Hand und nicht auf dem Kopf.
»Hier sind ganz schnell 20 Mann«
Kurz nachdem die Busse geparkt wurden, steigen die ersten bunten Gästefans aus. Sie sind jung bis sehr jung, trinken Schnaps und Bier, gehen kurz im Gebüsch pinkeln, ziehen sich dann ihre Clownsperrücken über, und: Sie wollen – genau wie überraschend viele Polizisten – nicht fotografiert werden. Auf keinen Fall. Was sie dem Fotografen recht unmissverständlich klarmachen. Nicht, wie die Polizisten, in Form von angedrohten Klagen. Sondern etwas direkter. »Hier sind ganz schnell 20 Mann«, sagt ein kleiner, untersetzter Kerl, vielleicht 19, vielleicht 23 Jahre alt. Er meint damit: Hier sind ganz schnell 20 Mann und machen Stress. Was wiederum die Frage aufwirft: Ist das noch normales Misstrauen gegenüber der Presse und einer Medienlandschaft, die zwischen Ultras und Hooligans gerne zu unterscheiden vergisst? Oder ist das schon Kategorie B? Sind die Polizisten wegen Typen wie dem kleinen, einigermaßen unsportlich wirkenden Mainzer Ultra so ausgerüstet, als würden sie heute auf Deutschlands gefährlichste MMA-Fighter treffen?
Als alle Mainzer ausgestiegen und umgezogen sind, setzt sich die Gruppe in Bewegung. Zwischen Polizei und Fans gibt es kaum Interaktionen, beide Seiten kennen die Abläufe, es ist für alle ein stinknormaler Samstagnachmittag. Die erwähnte Hundertschaft läuft vorne weg, weitere Polizisten »sichern« die Flügel, noch mal zehn Polizisten bilden die Nachhut. Dann, vorm Stadioneingang, als klar ist, dass es sich um einen Fotografen von 11FREUNDE handelt, hellt sich die Stimmung etwas auf. Ein Ultra, als Trommler stets vorne im Block mit dabei und heute eingepackt in ein buntes Narrenkostüm, erzählt, dass ihnen von der Polizei teilweise die Schminke verboten worden sei. Genau wie »Scheinwaffen«. »Leute, die als Piraten verkleidet sind, dürfen also keine Plastiksäbel mitbringen.« Vielleicht meinen Ultras das, wenn sie von fehlendem Fingerspitzengefühl der Polizei sprechen.
Normalerweise, erklärt Homolla wenig später, die Ultras sind jetzt im Stadion und bereiten ihre Karneval-Choreo vor, ist es bei Einsätzen so: Es gibt den Polizeiführer, heute Oberrat Schramm, der in der »Skybox« sitzt und die Gesamtverantwortung trägt. Stellt man sich das ganze als Organigramm vor, folgen eine Ebene unterhalb von Schramm fünf Einsatzabschnitte: die Einsatzabschnitte »Fanbegleitung Eins« und »Fanbegleitung Zwei«, die sich um den Weg der Heimfans und Gästefans ins Stadion und auch im Stadion selber um die Fans kümmern. Außerdem gibt es den Abschnitt »Verkehrsmaßnahmen«, den Abschnitt »Kriminalpolizeiliche Maßnahmen« (für alles, was in der Wache passiert) und den Abschnitt »Aufklärung«, also die szenekundigen Beamten. All diese Abschnitte haben Funkrufnamen, die zwar nicht veröffentlicht werden dürfen, die man sich aber vorstellen kann wie in einem US-Actionfilm: Roter Adler an Natter 2, kleiner Storch an Western 5000.
Die Stadionverbotler reisen nur fürs Feeling an
Eine, die zum Einsatzabschnitt »Aufklärung« gehört, ist Frau Denter. Sie ist als szenekundige Beamtin extra aus Mainz angereist, um aufzupassen, dass keine Fans mit bundesweitem Stadionverbot ins Stadion kommen. Sie steht jetzt, in der Halbzeitpause eines bis dahin torlosen und öden Spiels, in der Wache unter der Erde und wärmt sich auf. Ob sie nicht eigentlich im Block Wache schieben müsste? Ach was, sagt sie, wozu an einem Tag wie heute provozieren? Denn: Eine wie sie, im Block, das würde nicht allen gefallen. Sie trägt zwar einen pinken Fließpullover und Jeans, arbeitet in Zivil. Aber die harten Jungs, die, die als Kategorie B oder C kategorisiert werden, die erkennen sie natürlich trotzdem. »Und das sollen sie ja auch. Dann wissen sie genau, dass sich allein der Versuch gar nicht lohnt.« Wird ein Stadionverbotler dabei erwischt, wie er probiert, ein Stadion zu betreten, verlängert sich die Strafe in der Regel drastisch. Die vier Herren, die trotz Verbots heute mit aus Mainz angereist seien, erzählt Denter, wären nur fürs Feeling da. Die wüssten genau, wo sie hier während des Spiels, außerhalb des Stadions, in Ruhe ihr Bierchen trinken könnten. Die Kommunikation zwischen ihr und den Fan-Vertretern sei gut, sie mache den Job schon seit Jahren, privat habe sie in Mainz noch nie Ärger gehabt. Was die Kommunikation angeht, läuft es bei ihr vermutlich besser als bei den Kollegen in Berlin. Zumindest, wenn man nach dem »Kurvenecho«, dem Flugblatt der größten Berliner Ultragruppe »Harlekins«, geht. In der Ausgabe für das Spiel gegen Mainz gibt es einen Artikel über eine Veränderung des »Polizeiaufgabengesetztes« in Bayern. Darunter ein recht eindeutiger Slogan: »Kein Herthaner quatscht mit den Bullen!«
Der Kollege aus Berlin ist trotzdem tiefenentspannt. Heute ist er – breit gebaut, Dreitagebart, Typ Wenig-Schlaf-viel-Action-Draufgänger-Cop – nur einer von fünf szenekundigen Beamten, die sich um die Ostkurve kümmern. Ihre Aufgabe sei dabei weniger, Leute mit Stadionverbot abzuschrecken. »Die versuchen es bei Heimspielen ohnehin nur sehr selten.« Wichtiger seien sie, um Vorgänge in der Kurve richtig einzuordnen. Gehen plötzlich zehn, zwölf gewaltsuchende Fans in kleinen Grüppchen aus dem Block? Gibt es untereinander Stress? Normale Beamte hätten nicht die Einblicke in die Szene, um die gefährlichen Leute überhaupt zu erkennen. Ob es oft zu körperlichen Auseinandersetzungen käme? Eigentlich nicht. In der Regel schreitet die Polizei auch nicht mehr direkt im Block ein. Benimmt sich wer daneben, zündet Pyro oder zeigt ein verfassungswidriges Banner, wird er dabei von den Kameras aufgenommen und beim Verlassen des Stadions von den Einsatzkräften einfach »abgefischt«. Damit verfassungswidrige Banner auch als solche wahrgenommen werden, gibt es direkt im Stadion extra einen Staatsanwalt. Er arbeitet ehrenamtlich.
»Na komm doch!«
V on Schramms »Skybox« aus kann man heute kein verfassungswidriges Banner erkennen. Dafür aber einen Gruß der »Harlekins« an deren Kumpels in Karlsruhe: »20 Jahre Einsatzleitung Karlsruhe: Allet Jute Phoenix Suns« steht auf einem Banner in der Mitte der Kurve. Wegen eines ähnlich großen Banners hatte es im Herbst zwischen der Nordrhein-Westfälischen Polizei und den Berliner Ultras im Dortmunder Gästeblock geknallt. Angeblich hätten die Berliner im Schutz des Banners Straftaten vorbereiten können. Deswegen habe die Polizei es sicherstellen wollen. Und zerrte plötzlich an einem Stück Stoff. Auf den Einsatz der Kollegen in Westdeutschland angesprochen, möchte Schramm sich nicht positionieren. Vermintes Gebiet. Pyro allgemein: heikles Thema. Schaut man sich die ZIS-Zahlen für 2017/2018 an, fragt man sich, warum eigentlich. In der vergangenen Bundesligasaison verletzten sich von ca. 13,4 Millionen Stadionbesuchern in der ersten Liga wegen Pyro genau, Achtung, neun. Zum Vergleich: Elf Polizeibeamte verletzten sich durch den Einsatz von »polizeilichem Reizgas« selbst.
Feierabend: So richtig was los war heute nicht.
Die zweite Halbzeit verfolgen Heiko Homolla und Daniela Peters sitzend, direkt neben der »Skybox«, im Raum des Mannes, der für die Sicherheitsdurchsagen zuständig ist. Und der, möglichst unaufgeregt, die Wechsel des Gegners ansagt, oder, wie in der 46. Minute, ein Hertha-Gegentor. Echte Sicherheits-Durchsagen muss er heute nicht machen. Nur einmal fährt er aus der Haut. »Man ey!«, brüllt er, das Mikrofon ist zum Glück nicht offen, und haut dabei mit der flachen Hand wuchtig auf den Tisch. Ondrej Duda war der Ball versprungen. Ansonsten bleibt es heute im Stadion ruhig. Unterm Strich stehen nach dem Spiel, das Hertha noch mit 2:1 gewinnt, folgende Zahlen in der offiziellen Bilanz: 33.981 Zuschauer, 825 Gästefans, davon 80 Kategorie B und vier Kategorie C. Sieben Personen wurde wegen übermäßigem Alkoholkonsum der Einlass verweigert. Insgesamt erfasst wurden acht Straftaten. Eine Beleidigung, eine Körperverletzung, zwei Verstöße gegen das Gewerbegesetz und vier Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz. Knapp 200 Polizisten waren im Einsatz. Was der Einsatz genau gekostet hat? Kann oder will die Polizei nicht verraten.
»Gegen Mainz, ey! Allet voller Polizei«
Nach dem Spiel laufen die allermeisten Zuschauer, bedröppelte Mainzer wie fröhliche Herthaner, friedlich an den vor dem Stadion stehenden Polizisten vorbei. Manche der Polizisten tragen Maschinenpistolen, die Einsatzwagen stehen quer. Stichwort Breitscheidplatz. Die Zuschauer nehmen das alles kaum wahr, sie umlaufen die Staatsgewalt wie natürliche Hindernisse. Nur ein Hertha-Fan bekommt sich gar nicht mehr ein. »So `ne Pisse!«, schreit er. »So `ne Pisse!« Er trägt einen martialischen Pullover, in altdeutscher Schrift steht »Kämpfen und Siegen« darauf geschrieben, seine Freundin hat sich bei ihm eingehakt, halb, um ihn zu stützen, er ist alles andere als nüchtern, halb um ihn schnell über den vor Beamten nur so wimmelnden Coubertinplatz zu zerren. »Gegen Mainz, ey! Allet voller Polizei, ey!« Als er den Halbsatz einer vor einem Einsatzwagen gelangweilt herumstehenden Hundertschaft entgegen schleudert, dreht sich ein junger Polizist um. »Na wat denn?« fragt er provokant und laut, um ihn herum knapp 15 Kollegen. Der wütende Mann zögert – wat will der Vogel denn jetze? Klappe halten oder Terz machen? – man kann ihm beim Denken zusehen. Dann zerrt seine Freundin ihn weiter. »Na komm doch!«, ruft ihm der Polizist lachend hinterher.
Für Fragen, Anregungen oder Kommentare
Technische Umsetzung: